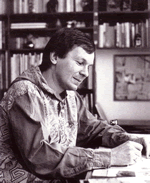Interview erschienen in »Welt der Arbeit« Nr. 12/Dezember 1991, Wien
Kinderbücher sind keine Kiloware
Georg Bydlinski gehört zur jüngeren Generation der österreichischen Kinderbuchautoren. Sein Bilderbuch »Der himbeerrote Drache« wurde zu einem Bestseller in den Kinderzimmern. Mit dem Autor Georg Bydlinski sprach Helmut Schneider.
Georg Bydlinski wurde 1956 in Graz geboren, wuchs dort und in einem Ort bei Bonn, wo sein Vater – ein bekannter Jurist – an der Universität lehrte, auf. In Wien studierte er Anglistik und Religionspädagogik. Bydlinski übte den Lehrberuf jedoch nie aus, weil er sich bereits während des Studiums seine ersten Sporen als freier Autor verdiente. Seinen momentanen Wohnort, die Südstadt, reflektierte er in dem Jugendbuch »Satellitenstadt« (Signal-Verlag), in dem es um die Situation Heranwachsender in den eintönigen Stadtrandsiedlungen geht.
Welt der Arbeit (WDA): Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Bydlinski: Ich schreibe eigentlich bereits seit meinem fünfzehnten Lebensjahr, vor allem Gedichte. Zum Kinderbuch bin ich durch Zufall gestoßen. Bei einer Studentenlesung habe ich Kontakt bekommen zu Käthe Recheis, die ja bereits seit vielen Jahren Kinder- und Jugendbücher schreibt. Ich habe dann begonnen, neben meinen Texten für Erwachsene für Kinder zu schreiben.
WDA: Waren das auch Gedichte?
Bydlinski: Zuerst Gedichte, aber bald schon ist eine längere, durchgehende Geschichte entstanden. »Pimpel und Pompel aus Limonadien« erschien 1980 und ist schon seit längerer Zeit vergriffen. Seitdem ist es für mich interessant, zwischen den Arbeitsbereichen zu wechseln – einmal für Kinder, dann für Erwachsene –, einmal Gedichte und einmal Prosa zu schreiben. Ich glaube, man vermeidet dadurch eine gewisse routinierte Glätte in den Texten.
WDA: Sie könnten nicht sagen, was Ihnen am meisten Spaß macht beim Schreiben?
Bydlinski: Es kommt ganz auf die Phase an, in der ich gerade drinnen bin. Es gibt Zeiten, da könnte ich gar nicht für Kinder schreiben. Als meine Kinder – wir haben drei Söhne – klein waren und der Alltag mit Kindern ausgefüllt war, habe ich fast nur für Erwachsene geschrieben. Zurzeit wechsle ich andauernd zwischen den Arbeitsbereichen.
WDA: War das früher auch schon so?
Bydlinski: Ich hab das Glück gehabt, dass ich zu einem Zeitpunkt dazugestoßen bin, als die damals bereits etablierte Gruppe der Wiener Kinder- und Jugendbuchautoren wie Mira Lobe, Christine Nöstlinger, Renate Welsh, Friedl Hofbauer, Ernst Ekker gemeinsam an dem Sammelband »Das Kindernest« gearbeitet haben. Im Verlauf der Arbeit an diesem Buch habe ich die Kollegen alle kennen gelernt. Das war für mich sehr schön, weil mich die Älteren nicht von oben herab anschauten, sondern von Anfang an eine solidarische Haltung eingenommen haben. Die Kritik an meinen Texten war immer eine konstruktive. Seit dem »Kindernest«, das 1979 erschienen ist, hat sich die Szene noch weiter aufgefächert – einige neue Kolleginnen und Kollegen sind dazugekommen –, aber der Kontakt ist mit allen sehr gut.
WDA: Beim Kinder- und Jugendbuch gibt es heutzutage kaum mehr Tabuthemen. Sparen Sie gewisse Themen aus?
Bydlinski: Es ist auch eine Frage an die Komplexität eines Themas. Im Prinzip glaube ich – die richtige Form der Darstellung vorausgesetzt –, dass eigentlich alles auch fürs Kinderbuch möglich ist, wobei ich eine Einschränkung machen möchte: Wenn man einem Kind nur Problembücher gibt, ist das sicher auch nicht gut. Ich glaube, es braucht da eine gewisse Ausgewogenheit zwischen dem Ernst und dem Spiel, zwischen dem reinen Nonsens, den die Kinder sehr lieben, und Themen, die nachdenklich machen. Nicht gut wäre aber andererseits, das „Heile-Welt-Schema“ zu verbreiten, denn die Kinder sehen ja schon in den Nachrichten, was los ist.
WDA: Das Kinderbuch ist ja auch ein Stiefkind der Kritik.
Bydlinski: Es gibt diese berüchtigten Sammelrezensionen, wie sie in der Presse dann vor Weihnachten aufscheinen, wo über jedes Buch zwei Zeilen geschrieben werden. Interessanter ist die Kritik der Kinder selbst. Ich komme oft in Schulen und finde da ein sehr ehrliches Publikum vor. Die zeigen einem sehr genau, ob ihnen etwas gefällt oder nicht. Da gibt es keine falsche Höflichkeit.
WDA: Die meisten Autoren klagen über die schlechte Bezahlung ihrer Arbeit. Haben es da die Kinderbuchautoren besser?
Bydlinski: Der Markt für Kinderbücher ist sicher größer als jener für Erwachsenenliteratur – abgesehen von Unterhaltungsromanen. Kinder lesen mehr als die Erwachsenen, das sieht man auch an den Leserzahlen in den Büchereien. Insgesamt ist die Situation aber gleich: das Risiko bleibt bei den Urhebern. Bei einem Bilderbuch muss sich der Autor das Honorar – höchstens 10 % des Ladenpreises (Stand 1991, mittlerweile meist geringer) – auch noch mit dem Illustrator teilen.
WDA: Hat das qualitätsvolle Kinderbuch eine Chance?
Bydlinski: Leider ist es auch so, dass Kinderbücher in Supermärkten oft nach Preis und Gewicht gekauft werden. Hans Magnus Enzensberger hat im Nachwort zu einem Band über alte Kinderreime Poesie als Lebensmittel bezeichnet. Das ist ein guter Vergleich, denn dass man für ein Lebensmittel Geld ausgibt, ist eigentlich selbstverständlich. Das Bewusstsein dafür fehlt freilich meist noch: Für ein Buch, an dem man mehrere Abende liest, zahlt man ungern eine Summe, die man ganz selbstverständlich für ein Abendessen ausgibt.