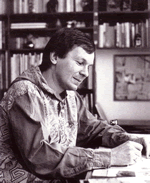Interview mit Ernst Grabovszki in »Anzeiger, Die Zeitschrift für die österreichische Buchbranche«, Jänner 2002
Manche Kinder können nur mehr zehn Minuten zuhören
Im Dezember 2001 erhielten Georg Bydlinski und Gerald Jatzek den Österreichischen Staatspreis für Kinderlyrik 2001. Georg Bydlinski über die Möglichkeiten, Kinder für Literatur zu begeistern.
Sie haben gemeinsam mit Gerald Jatzek den Österreichischen Staatspreis für Kinderlyrik erhalten. Lyrik ist am Buchmarkt unterrepräsentiert. Welche Beziehung haben Kinder zur Lyrik?
Kinder sind sehr offen. Mir fällt bei Lesungen auf, dass Kinder sehr schnell einen Bezug zur Lyrik herstellen, wenn sie Gedichte gesprochen vorgetragen bekommen. Wenn sie also mit Rhythmus, Reim, mit der Sprachmusik im akustischen Raum zu tun bekommen, springt der Funke schnell über und sie tun mit. Wenn es die Atmosphäre zulässt, können die Kinder auch mit-, weiter- oder umdichten. Ich habe den Eindruck, dass man mit Gedichten gut an sie herankommt, weil sie die tänzerische Bewegung solcher Texte mögen, die Rhythmik, das Wiedererkennen des Reims.
Welche Bedeutung hat der Preis für Sie?
Es freut mich, dass von einer internationalen, unabhängigen Jury eine Anerkennung ausgesprochen wird. Wenn es dann noch dazu der Staatspreis ist, ist die Freude umso größer.
Warum, glauben Sie, spielt Lyrik für Erwachsene so eine untergeordnete Rolle auf dem Buchmarkt?
Man könnte meinen, dass Lyrik für das Lesen zwischendurch sehr gut geeignet ist, denn Gedichte sind ja im Vergleich zumeist kurze Texte. Ich glaube aber, dass viele verlernt haben, zur Ruhe zu kommen, mit sich selbst allein zu sein, die Fragen, die Impulse, die ein Gedicht gibt, an sich herankommen zu lassen. Bei einer Kurzgeschichte kann man sich an einer Handlung orientieren, ein Gedicht will oft etwas von einem selbst. Es spricht die Gefühls- und Gedankenwelt an und fordert nahezu auf, sich einzubringen. Da liegt das Problem, glaube ich.
Macht es einen Unterschied für Sie, für Kinder oder für Erwachsene zu schreiben?
Man ruft verschiedene Sensibilitäten in sich wach, wenn man für Kinder oder für Erwachsene schreibt. Das ist zum Teil ein bewusster Prozess, zum Großteil aber ein unbewusster. Gerade für Gedichte brauche ich oft einen Impuls, die wenigsten entstehen am Schreibtisch. Es kann aus einer Beobachtung hervorgehen, einem Satz aus einem Gespräch, und das verbindet sich mit etwas, worüber ich gerade nachgedacht habe. Dann kommt vielleicht noch ein Bild hinzu, ein Rhythmus. Meine Gedichte für Erwachsene sind ruhiger, meditativer, bewusst verknappt. Sie versuchen, mit wenigen sprachlichen Bildern auszukommen und sind selten gereimt. All dieses Spielerische wie eben Rhythmus und Reim hat in meinen Gedichten für Kinder einen viel stärkeren Stellenwert.
Wie erleben Sie die Literaturvermittlung an Schulen – ist die Schule ein geeigneter Ort, um die Lust an Literatur zu wecken?
Diese Frage müsste man in mehreren Symposien behandeln … Es gibt sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die auch das Lustbetonte am Zugang zur Lyrik vermitteln. Andere verbinden es mit dem Lehrstoff und bewirken damit vermutlich das Gegenteil: etwas, was auswendig gelernt werden oder auf eine Weise analysiert werden muss, die an kriminalistische Mathematik denken lässt. Damit erreicht man, dass die jungen Leute sich von der Lyrik abwenden. Sobald und solange es möglich ist, ein Gedicht als etwas zu empfinden, das einem einen Raum für die eigene Befindlichkeit schafft, kann man auch in der Schule einiges erreichen: Was bewirkt das Gedicht, macht es mich für irgendetwas sensibel? Ich gehöre zu jenen, die noch lange Balladen auswendig lernen mussten. Wenn Gedichte im Unterricht zum Thema gemacht werden, sollten gleich mehrere ausgeteilt werden, und jedes Kind kann sich überlegen, welches es am meisten anspricht. Es gibt also Chancen, gleichzeitig aber auch das Risiko, dass man den Zugang zur Literatur eher noch erschwert.
Apropos Literaturvermittlung: Welche Erfahrungen haben Sie mit dem österreichischen Buchhandel in punkto Kinder- und Jugendliteratur gemacht?
Ich bin gebürtiger Steirer und seit vielen Jahren in der Steiermark zu Lesungen unterwegs. Dort, habe ich den Eindruck, funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Buchhandel und dem Österreichischen Buchklub der Jugend sehr gut. Wenn Lesungen an Schulen stattfinden, bekommen die Kinder Informationen über die Autorin oder den Autor, ihre/seine Bücher und die Möglichkeit, etwas zu bestellen. Es gibt aber in ganz Österreich Buchhandlungen, die Lesungen sponsern oder gar organisieren.
Sie tragen Lyrik in ihrer ursprünglichsten Art vor, nämlich als Verbindung von Wort und Musik. Wie reagieren die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer auf Ihre Lesungen?
Ich habe vor einigen Jahren begonnen, die Gitarre zu Lesungen mitzunehmen. Wenn man zwischendurch ein passendes Lied singt, kann man auf eine neue Art und Weise die Aufmerksamkeit der Kinder gewinnen. Sie sind es aus ihrer multimedialen Welt gewohnt, verschiedene Medien zu gebrauchen. Manche Kinder können nur mehr zehn Minuten einem Text zuhören und brauchen dann schon einen anderen Impuls. So passt es also ganz gut, wenn man zwischen einem Gedichtblock und einer Erzählung ein Lied einschiebt.
Im Februar erscheint Ihre Gedichtsammlung »Wasserhahn und Wasserhenne« bei Dachs. Können Sie uns über dieses Buch etwas sagen?
Es ist eine Auswahl aus ungefähr zwanzig Jahren Kinderlyrik und enthält die wichtigsten Gedichte aus den seit Jahren vergriffenen Büchern Der Mond heißt heute Michel (1981) und Die bunte Brücke (1992). Neue bzw. verstreut veröffentlichte Gedichte sind hinzugekommen. Das Buch ist in sechs Kapitel geteilt, die die Themen Freundschaft und Versöhnung behandeln, sprachspielerische Texte enthalten, den Jahreskreis, das Schlafen/Wachen/Träumen, den Alltag und skurril Märchenhaftes schildern. Carola Holland hat für den Band wunderschöne Farbvignetten beigesteuert.
Das Interview führte Ernst Grabovszki